Titel: Geht so | Beatriz Serrano | Verlag: eichborn
Vielen Dank für das Rezensionsexemplar!
Fake it till you make it in allen Lebenslagen – das scheint Marisas Motto zu sein. Ob bei der Arbeit, in der Beziehung zu ihrer Mutter oder zu ihrem Nachbarn, der irgendwas zwischen Freundschaft Plus und Situationship ist, Marisa gibt vor, jemand zu sein, der sie nicht ist.
Das allein könnte man vielleicht noch verkraften, wäre da nicht ihre Überheblichkeit gegenüber der anderen Menschen in ihrem Umfeld, die offenbar noch nicht so weit sind wie sie, das kapitalistische System zu durchschauen und für sich zu nutzen.
Worum geht’s?
Aber worum geht es eigentlich? Marisa ist knapp über 30, arbeitet in einer Madrider Werbeagentur, und ist mit ihrem Job und ihrem Leben kreuzunglücklich. Ihre Arbeit empfindet sie als sinnbefreite Lebenszeitverschwendung, ihr Leben als hohl und leer, und ihre Beziehungen zu den engeren Menschen in ihrem Leben als unvollständig und oberflächlich. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit träumt sie sich durch Unfälle, die sie haben könnte, um nicht zur Arbeit zu müssen, aber der Job ist auch zu gut bezahlt, als dass sie ihn einfach kündigen und als Künstlerin leben könnte. Sie erträgt ihr Leben nur noch mit Tavor und einer wilden Mischung aus Youtube-Videos.
Wie war’s?
Auf einer Seite kann ich mit Marisa extrem gut connecten. Wir sind beide Millennials, wir sind beide Angehörige der Generation, die sich für Hungerlöhne maximal ausbeuten lassen muss um halbwegs über die Runden zu kommen, und wir haben beide das kapitalistische Hamsterrad namens sinnbefreiter Arbeit durchschaut. Auch ich kenne die Fantasien auf dem Weg zur Arbeit, mir doch einfach etwas zu brechen, damit ich nicht hin muss, und die andauernde Erschöpfung, wenn man auf das eigene Leben blickt.
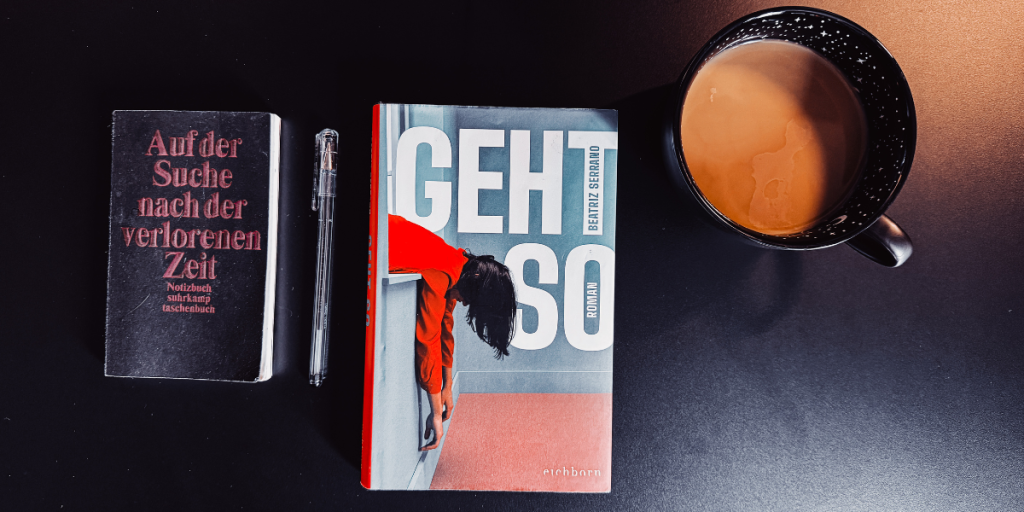
Arroganz macht dich nicht weise
Was Marisa für mich so unsympathisch macht, ist die Arroganz, mit der sie auf ihre Mitmenschen herabblickt, als hätte sie die Wahrheit und den Sinn des Lebens verstanden. Sie hat es genausowenig verstanden wie die Menschen, auf die sie herabblickt. Sie hat vielleicht durchschaut, wie der Kapitalismus arbeitende Menschen, vor allem Frauen, ausbeutet, bis sie gesundheitlich völlig am Ende sind, aber sie handelt nicht danach. Marisa verlässt selbst oft schon zur Mittagszeit die Arbeit – auf Kosten anderer. Sie gibt sich achso feministisch, aber beutet ihre Studierenden genauso aus wie andere Professoer*innen auch, um sich die Arbeit und damit das Leben zu erleichtern, frei nach dem Motto „Schlecht geklaut ist besser als gut gearbeitet”. Sie entschuldigt das mit: „Wenn du erst mal kapiert hast, dass die meisten Menschen auf der Arbeit dich komplett entmenschlichen, wird es viel einfacher, sie auch zu entmenschlichen.” Sie ist damit nicht besser als das System, das sie kritisiert. Das kann man natürlich als Momentaufnahme der Gesellschaft sehen, denn so wie Marisa werden es viele Menschen in ihrem Alter machen. Sich selbst die nächste sein, vor allem auf sich selbst gucken, und eine „Nach mir die Sintflut”-Attitüde verinnerlichen.
Langweiliges Leben? Oder vielmehr Frieden?
Und es ist nicht nur die Arbeitseinstellung, die sie von ihrem hohen Podest belächelt. Auf einem Firmenausflug setzt sich ein Kollege neben sie.
„Ich frage mich, ob ich nicht vielleicht glücklicher sein könnte, wenn ich mit jemandem wie Carlos verheiratet wäre, mit einem ganz gewöhnlichn Typen, ein bisschen langweilig, aber einer, den ich fragen würde, was er montags zu Abend essen möchte, wenn er von der Arbeit heimkommt, bevor ich noch im Supermarkt vorbeischaue. Jemand, mit dem ich eine bestimmte Netflix-Serie wegsuchten könnte, nur um die Handlung zwei Wochen später wieder gemeinsam zu vergessen. […] Ein einfaches Leben, nichts dramatisches, todlangweilige Routine, gemäßigtes Glück.”
Ist dieses Leben wirklich so langweilig? Oder sind wir es nur so gewohnt, in einem permanenten Krisenzustand zu leben, weil ständig irgendwas passiert – 9/11, Immobilienblase, unzählige globale Finanzkrisen, Pandemie, mal wieder kurz vor 3. Weltkrieg – dass wir glauben, unsere romantischen Beziehungen müssten ebenfalls eine Katastrophe nach der nächsten sein? Sind wir es einfach nicht mehr gewohnt, dass ruhig und beständig tatsächlich sowas wie ein kleiner Frieden sind, und wir die Menschen, die das für sich geschaffen haben, eher beneiden sollten statt auf sie herabzublicken von unseren Schlachtrössern, auf denen wir unser Leben bestreiten? Ich denke, es ist letzteres. Und dass Marisa sich das zwar fragt, aber im Endeffekt doch auf eine Art großen Lottogewinn des Lebens wartet, zeigt, dass sie nicht weiser ist als ihre Mitmenschen. Nur altklüger und arroganter.
Die Müdigkeit der Millennials
Es gibt allerdings einen Aspekt, der unfassbar gut dargestellt wird: die Verzweiflung und Einsamkeit meiner Generation. Millennials sind die erste Generation, bei der das gesellschaftliche Versprechen gebrochen wurde, dass man sich in der Schule und der Ausbildung nur genug anstrengen müsse, dann bekäme man einen gut bezahlten Job, könne sich Haus und Familie leisten, natürlich mit Auto und jährlichem Urlaub im Ausland. Was wir bekamen? Den Spitznamen “Generation Praktikum”, weil wir uns von ausbeuterischem Praktikum zu ausbeuterischen Praktikum hangelten in der Hoffnung, endlich genug im Lebenslauf stehen zu haben, damit wir einer angemessenen Bezahlung würdig sind. Wir bekamen und bekommen herablassende Kommentare der vorangehenden Generationen – Boomer und Gen X – dass wir zu verweichlicht seien, nicht arbeiten wollen und deswegen kein Haus hätten, wohl wissend, dass es diese Generationen sind, die die Immobilienmärkte zerstört und die Löhne in den Keller getrieben haben, um sich selbst zu bereichern. Wir Millennials haben begriffen, dass wir nicht gewinnen können, und setzen andere Prioritäten. Lebenszeit über Gehaltsscheck, kleine Freuden statt große Träume (die haben wir immer noch, aber wir sind in der Realität angekommen), Sarkasmus und Ironie als Überlebensstrategie. Es gibt das Meme über Millennials, dass sie bei jeder Nachricht über ein „once in a lifetime, life changing Event” nur noch müde abwinken und erwidern: „Ist schon das dritte diese Woche, und es ist erst Dienstag.” Und obwohl wir wissen, dass es den meisten in unserer Generation so geht, versuchen wir trotzdem, anderen vorzumachen, unser Leben sei nicht von Verzweiflung und Resignation durchdrungen. Nicht dauerhaft, das wäre fatal, aber die Unterströmungen sind deutlich davon geprägt. Und Marisa beschreibt das sehr treffend:
„Wahrscheinlich ist es das, was wir alle machen. Auf WhatsApp unsere Hallowiegehts verschicken und hoffen, dass die anderen nicht merken, wie verzweifelt, einsam, leidend und traurig wir sind. Viele Ausrufezeichen tippen, damit man uns die Entmutigung nicht anmerkt. Diese ultra kurzfristigen Einladungen auf ein Bier oder einen Wein, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt und wir nach irgendeiner Art menschlichem Kontakt gieren. Diese „Na, was macht ihr so?” and eine Gruppe Freunde, die du schon seit Monaten nicht mehr getroffen hast, weil Erschöpfung und Trägheit von dir Besitz ergriffen haben, die sich aber gerade verflüchtigen, und das einzige, was du jetzt brauchst, ein Standort auf Google Maps ist und ein „Komm dazu”. Weil du weißt, wenn du erst da bist, übertönt der Geräuschpegel der Bars, das Klirren der Gläser und das Schnattern der eigenen und fremden Gespräche das immer schriller werdende Kreischen deiner Gedanken.”
Was bleibt?
Serrano greift so viele Eindrücke, Überzeugungen, Weltanschauungen der Millennials unfassbar gut auf und seziert sie, aber sie lässt ihre Protagonistin daraus keine Schlüsse ziehen. Mag sein, dass sie damit ein gutes Abbild von Gen Y gezeichnet hat. Aber dieses Bild sehe ich jeden Tag, spätestens wenn ich Social Media öffne, ich brauche das nicht nochmal in Buchform auf die Spitze getrieben.
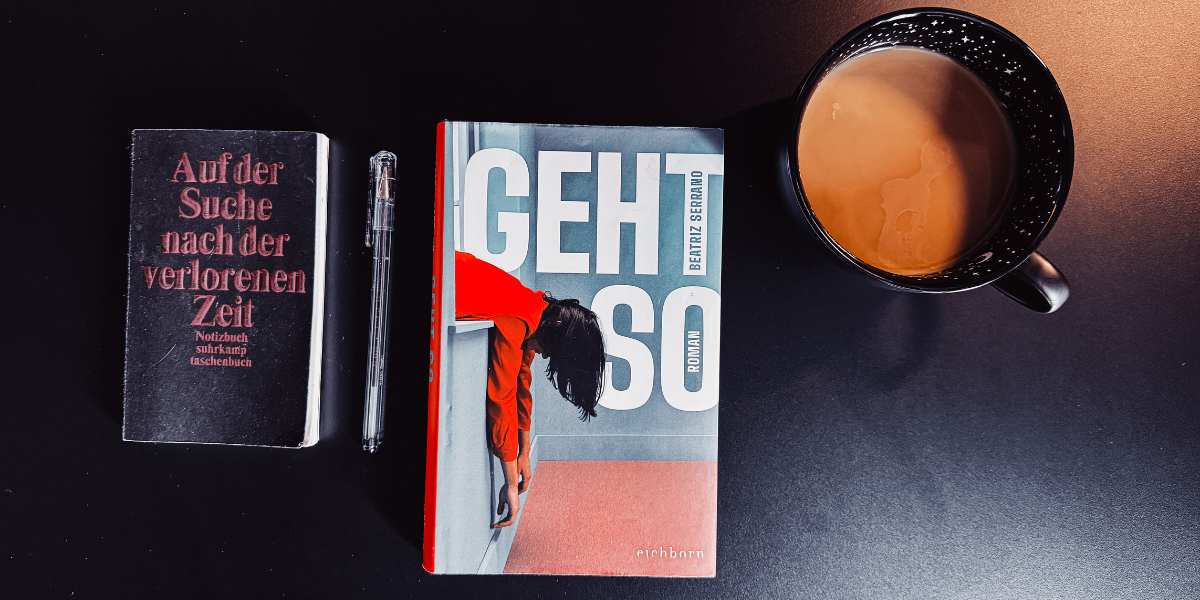
Welcome back! 🎉
Ich habe die Leseprobe gelesen und hatte einen merkwürdigen ersten Eindruck, weshalb ich mich doch gegen dieses Buch entschieden habe. Deine Rezension bestätigt mich in der Vermutung, dass das Lesen des ganzen Buches mich wohl nur sehr frustriert hätte, so realistisch die Beschreibungen auch sein mögen. Daher danke fürs Teilen!
Liebe Grüße, Henrike
Ahoi!
Danke für das Re-Willkommen 😀 Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, den Blog auf Kommentare zu prüfen, insofern entschuldige bitte die späte Antwort!
Ich hätte das Buch so gerne gemocht, gerade weil es um die tlw. doch recht traurige Arbeitswelt der Millennials geht – aber ich komme auf Marisa einfach nicht klar. Sehr, sehr schade, vor allem, weil mir das Buch empfohlen wurde, und der Mensch bisher immer ein recht gutes Händchen für mich hatte.
Cheerio
Mari
Das kommt mit der Zeit wieder, keine Sorge. Mir ging es nach meiner Pause auch anfangs so. Bist du denn jetzt wieder richtig zurück, mit regelmäßigen Beiträgen usw, oder planst du eher sporadisch zu schreiben?
Ja, eine gute Repräsentstion, die auch angenehm zu lesen ist, wäre wirklich mal schön … 🤷🏻♀️
Eigentlich will ich wieder regelmäßiger was schreiben. Vermutlich nicht in der Taktung wie früher, aber ich habe gemerkt, dass mir bei Instagram ganz schnell die Zeichen ausgehen, vor allem, wenn ich was zu motzen habe 😀 Allein deswegen muss ich den Blog aus dem Wachkoma holen, ich kann mich ums Verrecken nicht kurzfassen!
Umso besser für uns – ich lese sehr gerne deine Wutanfälle … 🙂
Coole Rezension, cooler neuer Look. 🙂
Danke 🙂
Der Look wird sich wohl noch ein paar Mal ändern, ich bin im Moment nicht ganz zufrieden mit dem Design :/